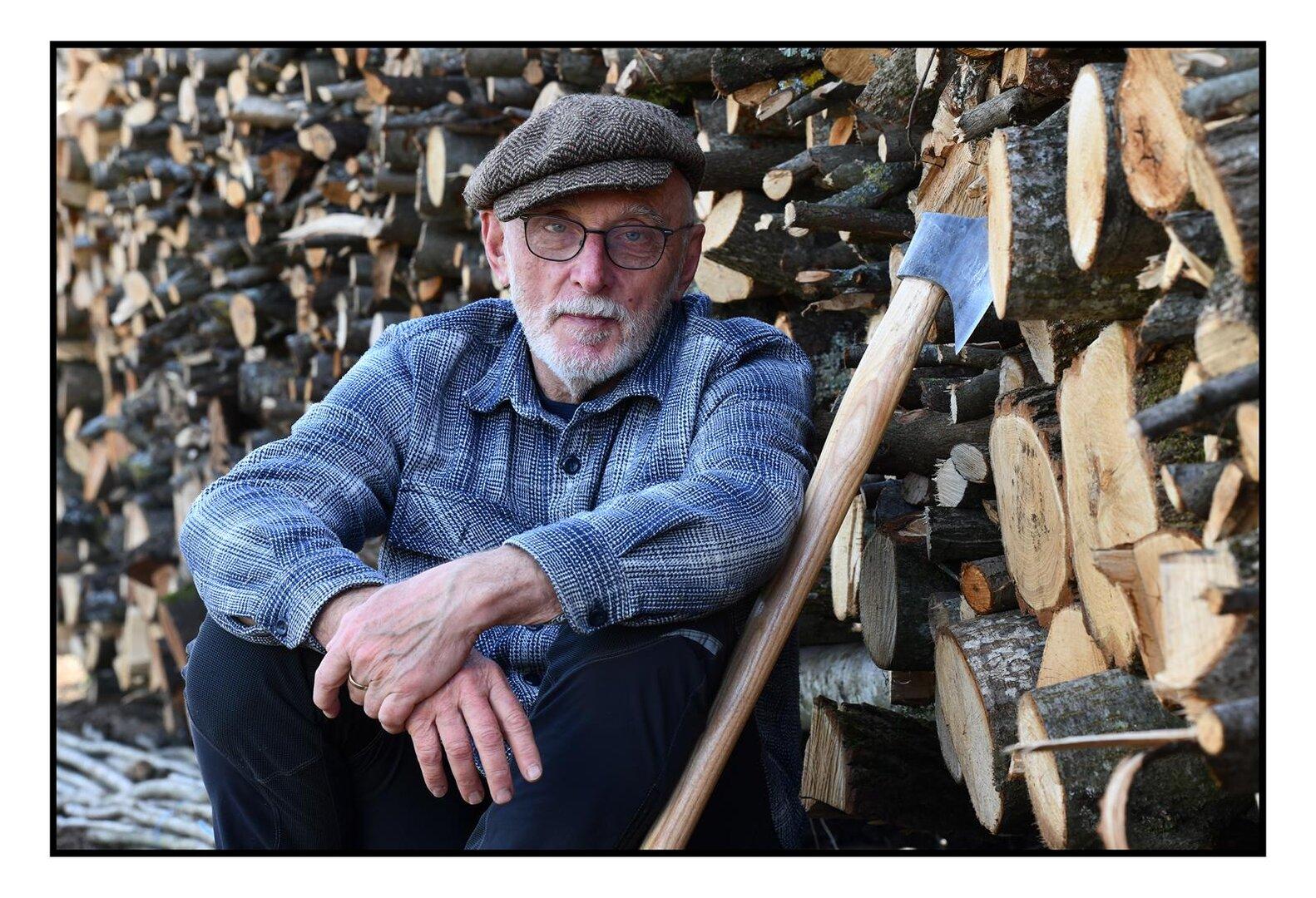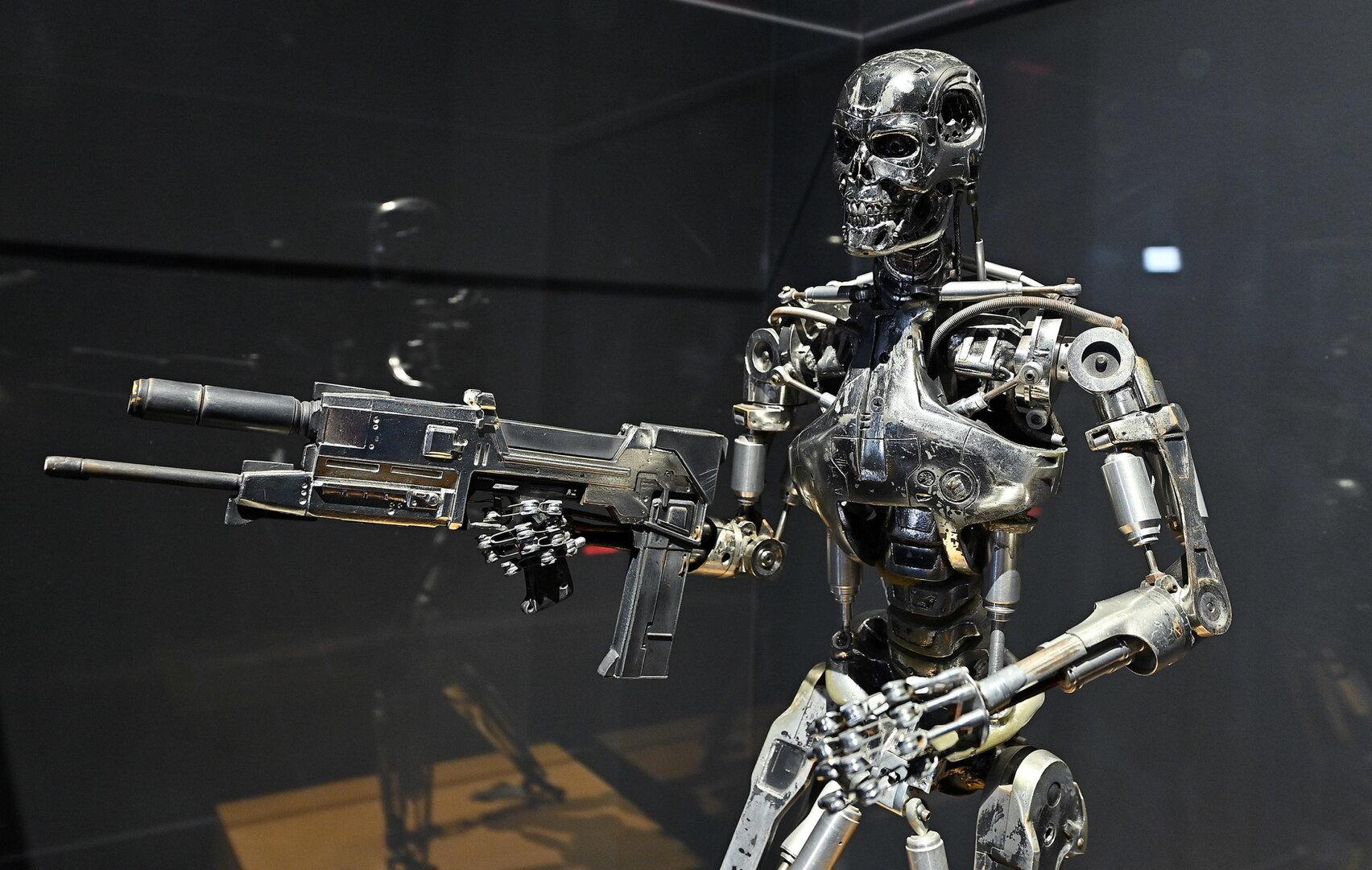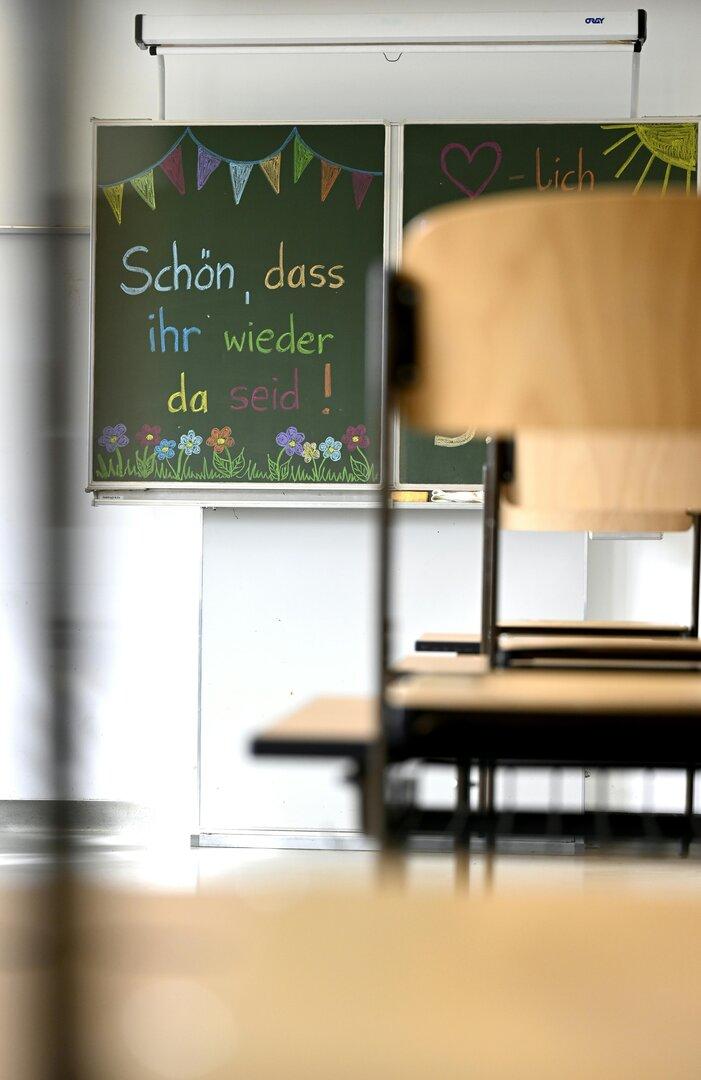Daniel Wissers "Smart City": Wenn Diktatur auch schon egal ist
Buckminster Fuller, genannt Bucky, war ein amerikanischer Architekt, der mit seinen Bauwerken die Welt nicht nur verändern, sondern neu erfinden wollte. Die Weltordnung, wie sie sich zu seinen Lebzeiten (1895–1983) darstellte, gehörte seiner Ansicht nach umgekrempelt. In „NEUDA“, einer sogenannten „Smart City“, hat man sich von seinen Ideen „inspirieren“ lassen. Auch hier will man so etwas wie eine neue Weltordnung. Fuller hätte es freilich nicht gefallen, dass seine Visionen zur Verbesserung des Lebens aller Menschen in einen Orwell’schen Horror ausarten, wie das in Daniel Wissers neuem Roman „Smart City“ der Fall ist. Man schreibt mutmaßlich das Jahr 2037. NEUDA, das zwischen Wien und der Slowakei liegt, ist eine saubere, nachhaltige neue Welt ohne Kriminalität, Abgase, Plastikmüll und unliebsame Ausländer. Dafür mit permanenter Überwachung. Oben kreisen Drohnen, unten bewegen sich geräuschlos Reinigungsroboter. Wer hier lebt, muss ständig Smartwatch tragen. Daheim gibt’s zudem Videoüberwachung. Wer hier wohnen will? Ziemlich viele. Zu Beginn des Romans hat NEUDA 17.953 Einwohner, in anderen Bundesländern sind weitere „Smart Citys“ geplant. Die Versprechen von Sicherheit, Lebensqualität und harmonischem Zusammenleben sind den Menschen mehr Wert als Eigenständigkeit und Gerechtigkeit. Das wird auch die Journalistin Morag Oliphant erfahren. Nachdem ihr Mann und ihre Tochter in Wien bei einem Überfall von Unbekannten erschlagen wurden, strebt sie nach einem Neuanfang in dieser schönen neuen Welt. Dass die Schönheit einen Preis hat, den jene bezahlen, die man zu Menschen zweiter Klasse deklariert hat, wird von Morag aufgedeckt, von anderen NEUDA-Bewohnern aber nicht gerne gehört. Auch eine neue politische Bewegung, die sich für mehr Selbstbestimmung der Bürgerinnen und Bürger einsetzt, wird zur bitteren Erkenntnis gelangen: Die Menschen wollen nicht frei sein. Freiheit bedeutet Verantwortung. Lieber toleriert man, dass „eine kleine Diktatur“ das Dasein lenkt. Immerhin hat man’s besser als alle anderen auf der Welt. Überwachungs-Dystopie Schwer zu sagen, welche Art Roman Wisser hier geschrieben hat. Eine Überwachungs-Dystopie à la Orwell oder Huxley, schon klar. Außerdem einen Politkrimi – Wisser hat darin Erfahrung, er ist unter dem Pseudonym Simon Ammer auch Krimiautor. Und er ist genauer Beobachter österreichischer Innenpolitik. Der Mann, der in „Smart City“ bei einer Demonstration von einem Security zusammengeschlagen wird, heißt nicht zufällig so ähnlich wie ein ehemaliger SPÖ-Abgeordneter, der am Rande des Wiener Korporationsballs einst, unter intensivem Wegschauen der Polizei, brutal verprügelt wurde. Überhaupt, die Namen. Hier wird’s satirisch. Der Bundeskanzler von der „Zentrumspartei“ heißt Gawan Rindfleisch, sein Mitbewerber von der „Heimatpartei“ ist ein gewisser Kai Dominik Smrtak. Alle miteinander werden von Konzernen korrumpiert. Was sagt das Volk dazu? Es zuckt mit den Schultern. „Politik war immer schon so.“ Cover Daniel Wisser: „Smart City“ Luchterhand. 412 Seiten. EUR 25,70