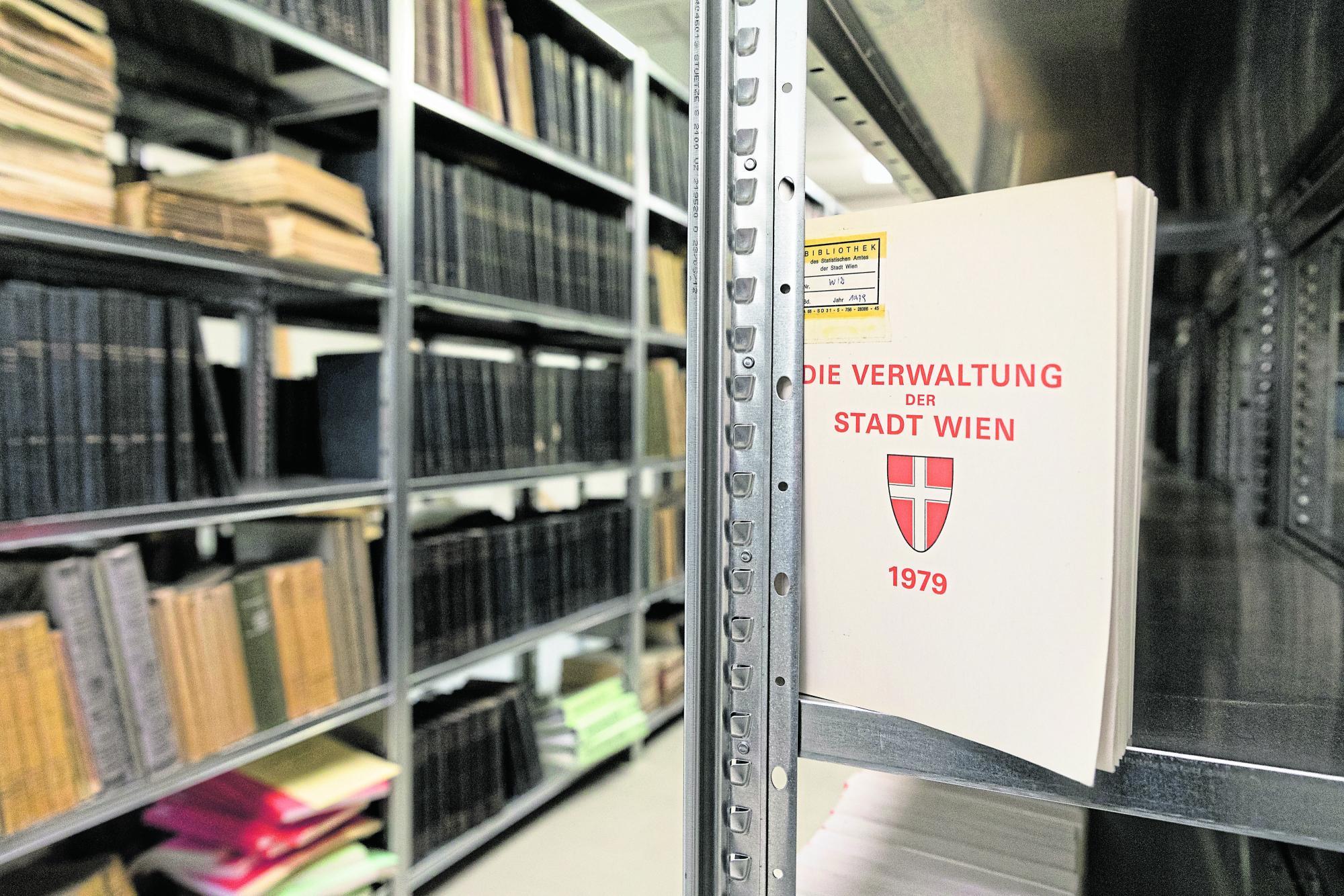LIMAK Business School: So gelingt es, mit dem eigenen Unternehmen zukunftsfähig zu bleiben
Strategisch denken, unternehmerisch handeln, Zukunft sichern: Warum der Mut, bewährte Strategien und Strukturen kritisch zu hinterfragen, und Freiraum für unternehmerisches Denken in einer Organisation heute zum Schlüssel nachhaltiger Wettbewerbsfähigkeit wird.