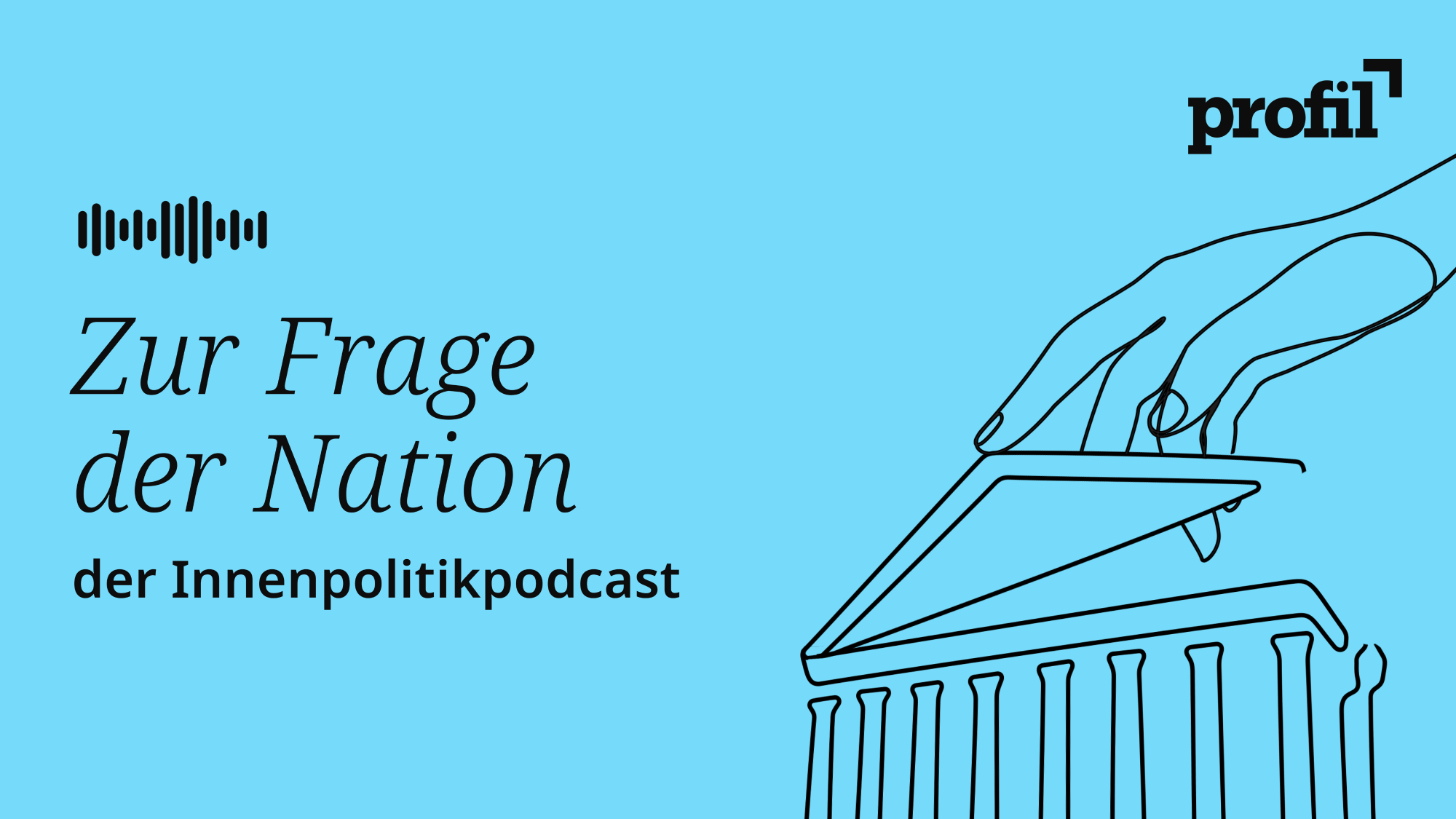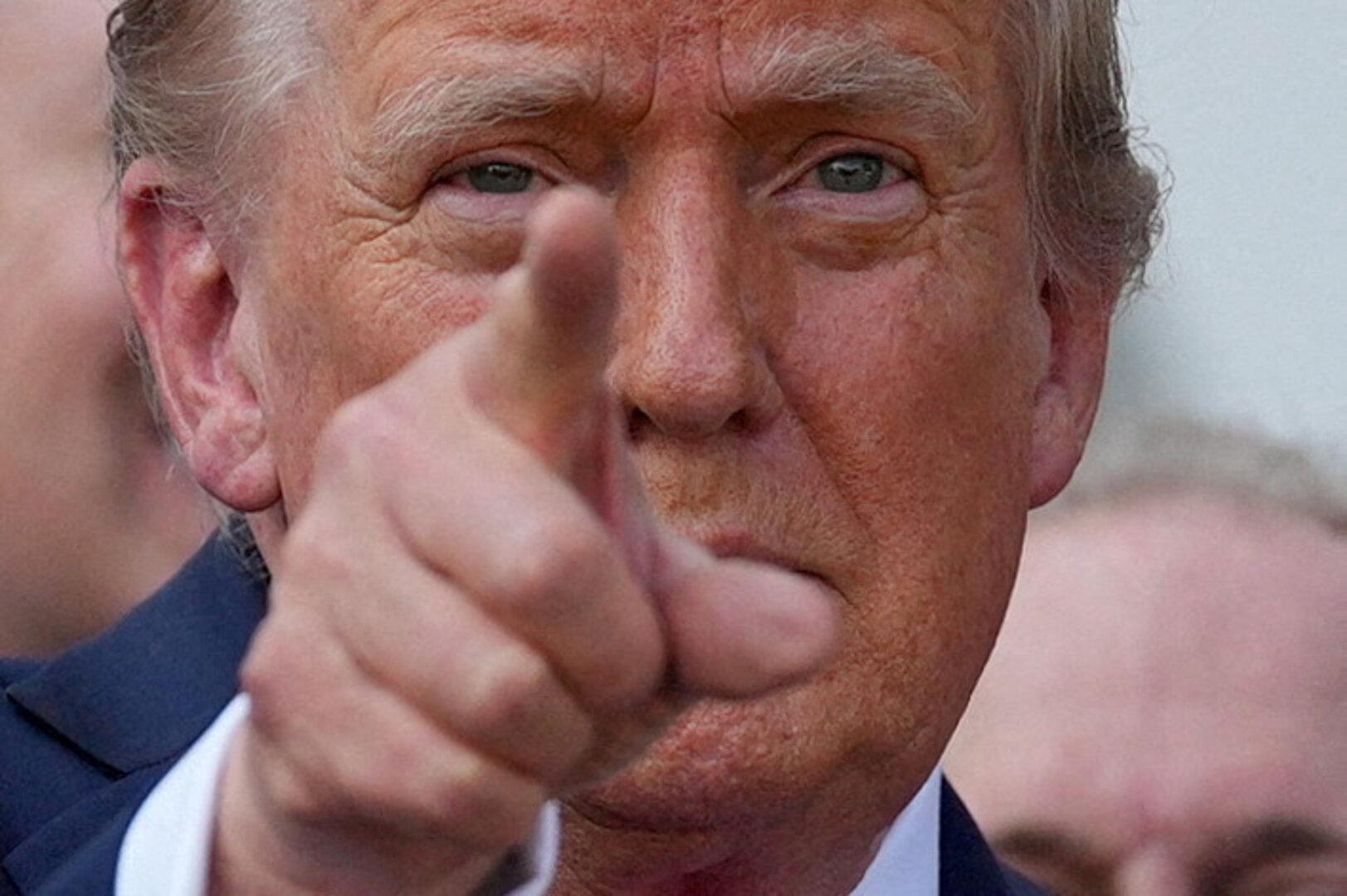Stimmt das?: Wurden Trumps Zölle durch das jüngste Gerichtsurteil gekippt?
Ein US-Berufungsgericht hat einen Großteil der von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle für rechtswidrig erklärt. Seine Zollpolitik wurde damit gekippt, war teilweise zu lesen. Aber stimmt das?